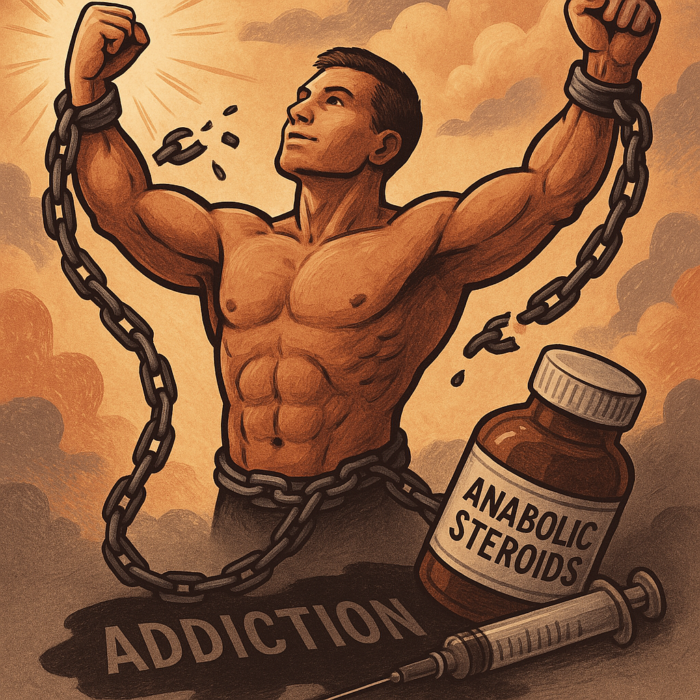Das Wichtigste in Kürze
✓ AAS wirken nicht wie klassische Drogen über einen akuten „Kick“, sondern verändern langfristig die hormonelle Balance und die Empfindlichkeit von Belohnungs- und Botenstoffsystemen im Gehirn.
✓ Entzugserscheinungen wie depressive Verstimmungen, Angst oder Schlafstörungen nach dem Absetzen sind möglich.
✓ Die Diagnose einer AAS-Abhängigkeit ist umstritten: In der ICD-10 werden sie nicht als suchtverursachende Substanzen klassifiziert, in der DSM-5 hingegen schon.
✓ Du hörst lieber Podcasts? Dann findest du die ausführliche Folge zu anabolen Steroiden mit wissenschaftlichem Deep Dive jetzt bei Psychoaktiv auf deinem Lieblings-Player!
Inhalt
> Wie werden Anabole Steroide aktuell diagnostisch eingeordnet?
> Was passiert im Gehirn unter Anabolen Steroiden?
> Entsteht bei AAS eine Toleranz wie bei anderen Drogen?
> Wann spricht man von einer Abhängigkeit bei Anabolen Steroiden?
Wie werden Anabole Steroide aktuell diagnostisch eingeordnet?
In der ICD-10, dem gängigen Diagnosekatalog in Deutschland, werden Anabole Steroide (AAS) unter F55.5 („Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen“) geführt – zusammen mit Mitteln wie Abführmitteln, Schmerzmitteln ohne Opiate, Hustenmitteln, Nasentropfen, Vitaminen, Tonika und pflanzlichen Arzneimitteln. Auch in der neuen ICD-11 bleibt AAS-Missbrauch unter „Störungen durch nicht-psychoaktive Substanzen“ eingeordnet (6C4H). Das ist zwar ein Fortschritt in der Anerkennung schädlicher Effekte, verweigert aber weiterhin die Einordnung als klassische Substanzgebrauchsstörung.
Im US-amerikanischen DSM-5 ist man weiter: Dort existiert die Diagnose Anabolic-Androgenic Steroid Use Disorder. Studien zeigen, dass AAS-Abhängigkeit oft übersehen wird – gerade weil kein akuter Rauschzustand eintritt und die Effekte langsamer einsetzen als bei klassischen Drogen.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
Was passiert im Gehirn unter Anabolen Steroiden?
Obwohl AAS keine klassischen psychoaktiven Substanzen sind, wirken sie stark auf das zentrale Nervensystem. Sie binden an Androgenrezeptoren – auch im Gehirn, insbesondere im limbischen System, das für Motivation, Emotion und Belohnung zuständig ist. Die Folge: Eine veränderte Sensitivität für Dopamin, Serotonin und Endorphine.
Während des Konsums berichten viele über gesteigertes Selbstvertrauen, Antrieb und emotionale Stabilität. Doch nach dem Absetzen kann es zu einem rapiden Rückgang dieser Botenstoffe kommen – mit Symptomen wie depressiver Verstimmung, Angst, Schlafstörungen und Suizidgedanken. Diese Entzugssymptome können über Wochen bis Monate anhalten, was die Rückfallgefahr erhöht.
Sie fragen sich, ob Ihr Konsum problematisch ist oder ob Sie Unterstützung brauchen? Vereinbaren Sie ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch – und wir schauen gemeinsam auf Ihre Situation.
Entsteht bei AAS eine Toleranz wie bei anderen Drogen?
Die klassische pharmakologische Toleranz – also der Effekt, dass man für die gleiche Wirkung immer mehr konsumieren muss – zeigt sich bei AAS nicht im selben Maße wie bei Substanzen wie Heroin oder Kokain. Und doch kommt es bei vielen Nutzenden zur Dosissteigerung. Warum?
Drei Faktoren sind hier entscheidend:
- Psychologische Dynamik: Eine Fixierung auf das eigene Körperbild, wie bei Muskeldysmorphie, treibt manche dazu, immer weiter zu dosieren.
- Hormonelle Anpassung: Der externe Testosteronzufluss hemmt die körpereigene Produktion. Der Körper wird „faul“ – und höhere Dosen sind nötig, um die Wirkung zu erhalten.
- Stacking-Praktiken: Die Kombination verschiedener Steroide („Stacking“) führt oft unbewusst zu immer höheren Gesamtdosen.
Es liegt also eine Toleranzentwicklung vor – wenn auch auf andere Weise als bei psychoaktiven Substanzen.
Wann spricht man von einer Abhängigkeit bei Anabolen Steroiden?
Entscheidend ist: Viele AAS-Nutzer zeigen klare Symptome einer Substanzgebrauchsstörung. Dazu zählen:
- Entzugssymptome nach dem Absetzen
- Dosissteigerung trotz Nebenwirkungen
- Verlust der Kontrolle über den Konsum
- Fortgesetzter Gebrauch trotz negativer Folgen
Hinzu kommt die psychische Abhängigkeit: Das Gefühl, ohne AAS kleiner, schwächer oder weniger leistungsfähig zu sein. Viele erleben und fürchten einen sogenannten „Crash“ nach dem Absetzen – ein massiver Stimmungsabfall und das Gefühl, „nicht mehr ganz man selbst“ zu sein. Das soziale Umfeld kann diese Dynamik zusätzliche verstärken – etwa in Fitness-Communities, in denen AAS zum Alltag gehören, oder durch Social Media, das ein unrealistisches Körperideal propagiert.
Psychoaktiv+ – Deine Vertiefungsplattform für Drogen, Konsum & Sucht
Der kostenlose Podcast Psychoaktiv liefert dir seit Jahren fundiertes Wissen – differenziert, stigmafrei und akzeptanzbasiert.
Mit Psychoaktiv+ bekommst du endlich das, was im Free Feed nicht umsetzbar ist: Struktur, Anwendung und Austausch.
📂 Hörleitfäden für Struktur
🎧 Bonusfolgen für Praxisnähe
💬 Webinare für echten Austausch
Unterstütze unabhängige Aufklärung und tauche mit mir tiefer in den Themenkomplex Drogen, Konsum und Sucht ein:
Quellen für Podcastfolge & Blogartikel
AlShareef, S., Gokarakonda, S. B., & Marwaha, R. (2023). Anabolic Steroid Use Disorder. StatPearls. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567567/
Bond, P., Smit, D. L., & de Ronde, W. (2022). Anabolic-androgenic steroids: How do they work and what are the risks? Frontiers in Endocrinology, 13, 1059473. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1059473
Butzke, I., & Bruggmann, P. (2023). Rechtlich unsichere Versorgung von Anabolika-Konsumierenden. Schweizerische Ärztezeitung. https://doi.org/10.4414/saez.2023.21677
Gunnarsson, B., Entezarjou, A., Fernández-Aranda, F., Jiménez-Murcia, S., Kenttä, G., & Håkansson, A. (2022). Understanding exercise addiction, psychiatric characteristics and use of anabolic androgenic steroids among recreational athletes – An online survey study. Frontiers in Sports and Active Living, 4, 903777. https://doi.org/10.3389/fspor.2022.903777
Grönbladh, A., Nylander, E., & Hallberg, M. (2016). The neurobiology and addiction potential of anabolic androgenic steroids and the effects of growth hormone. Brain Research Bulletin. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2016.05.003
Iff, S., Butzke, I., Quednow, B. B., Gupta, R., Imboden, C., & Claussen, M. C. (2021). Image and performance enhancing drugs im Freizeitsport. Swiss Medical Forum, 21, 843–847. https://doi.org/10.4414/smf.2021.08867
Kopp, V. (2014). Medikamentenmissbrauch bei männlichen Kraftsportlern und Bodybuildern im Breitensport: Eine qualitative Studie mit Blick auf die Relevanz für die Gesundheitsförderung. Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen.
Magnolini, R., Falcato, L., Cremonesi, A., Schori, D., & Bruggmann, P. (2022). Fake anabolic androgenic steroids on the black market – a systematic review and meta-analysis on qualitative and quantitative analytical results found within the literature. BMC Public Health, 22, 1371. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13734-4
Swiss Society for Addiction Medicine (SSAM). (2022). Nichtmedizinischer Gebrauch von anabolen androgenen Steroiden: Prävention, Diagnostik und Therapie.
Wood, R. I., & Stanton, S. J. (2009). Issues for DSM-V: Clarifying the diagnostic criteria for anabolic–androgenic steroid dependence. American Journal of Psychiatry, 166(6), 642–645. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09030397